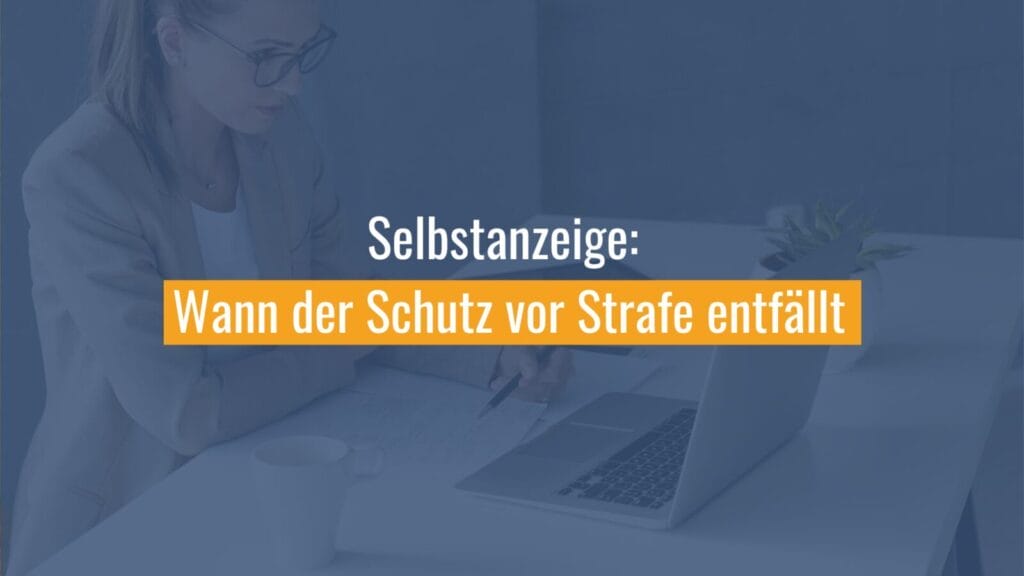Was ist eine Selbstanzeige?
Im Steuerrecht haben Steuerpflichtige die Möglichkeit, eine Selbstanzeige zu stellen, wenn sie Fehler bei der Steuererklärung bemerken. Eine Selbstanzeige ermöglicht es, Steuerhinterziehung zu korrigieren und die Strafe zu vermeiden, die mit einer Steuerhinterziehung verbunden wäre. Doch diese Straffreiheit ist nicht unbegrenzt – es gibt klare Bedingungen, unter denen eine Selbstanzeige nicht mehr strafbefreiend wirkt.
Im folgenden Beitrag erfahren Sie, wann eine Selbstanzeige nicht mehr dazu führt, dass der Steuerpflichtige strafrechtlich verschont bleibt.
Wann verliert eine Selbstanzeige ihre strafbefreiende Wirkung?
Die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann die Selbstanzeige nicht mehr vor strafrechtlichen Konsequenzen schützen. Die wichtigsten Gründe, warum eine Selbstanzeige nicht mehr strafbefreiend ist, sind:
1. Wenn die Selbstanzeige verspätet erfolgt
Eine Selbstanzeige kann nur dann eine strafbefreiende Wirkung entfalten, wenn sie vor der Entdeckung der Steuerhinterziehung durch das Finanzamt erfolgt. Sobald das Finanzamt Ermittlungen aufgenommen hat, etwa durch eine Außenprüfung oder die Einleitung eines Strafverfahrens, ist eine Selbstanzeige nicht mehr möglich.
Das bedeutet, dass Sie sich melden müssen, bevor das Finanzamt auf den Fehler aufmerksam wird. Wenn bereits eine Außenprüfung angeordnet oder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, ist es zu spät, um von der Straffreiheit einer Selbstanzeige zu profitieren.
Ein praktisches Beispiel aus der Praxis zeigt, wie kritisch es sein kann, wenn eine Außenprüfung bereits angeordnet wurde:
Ein Steuerpflichtiger stellte eine Selbstanzeige, weil er dachte, er könne die Situation noch retten. Doch das Finanzamt lehnte die Strafbefreiung ab, da die Außenprüfung bereits eingeleitet worden war. In diesem Fall war die Selbstanzeige zu spät und schützte nicht vor den Folgen der Steuerhinterziehung.
2. Wenn die Selbstanzeige unvollständig ist
Eine Selbstanzeige muss vollständig sein. Das bedeutet, dass der Steuerpflichtige alle Steuerstraftaten der letzten zehn Jahre offenlegen muss. Eine teilweise Selbstanzeige, bei der nur ein Teil der hinterzogenen Steuern korrigiert wird, ist nicht mehr möglich. Früher gab es die Möglichkeit der sogenannten Teilselbstanzeige, bei der man nur einen Teil der hinterzogenen Steuern nachmeldete, um eine strafbefreiende Wirkung zu erzielen. Diese Option wurde jedoch abgeschafft.
Es reicht also nicht, nur einige Fehler zu berichtigen, während man andere unbeachtet lässt. Eine vollständige Offenlegung aller relevanten Steuerstraftaten ist erforderlich, um von der Straffreiheit zu profitieren.
Ein Beispiel verdeutlicht dies: Ein Steuerpflichtiger hatte insgesamt 1,5 Millionen Euro hinterzogen, entschied sich jedoch, nur gut 500.000 Euro in seiner Selbstanzeige anzugeben, um knapp unter der Millionengrenze zu bleiben. Diese Praxis wurde jedoch abgeschafft. Steuerpflichtige sind nun verpflichtet , alle relevanten Informationen offenzulegen.
Außerdem muss das Finanzamt aufgrund Ihrer Selbstanzeige in der Lage sein, die hinterzogenen Steuern festzusetzen. Wenn Sie beispielsweise Einnahmen aus dem Jahr 2023 nicht angegeben haben, muss in Ihrer Selbstanzeige konkret vermerkt werden, dass diese Einnahmen in Höhe von X Euro nicht angegeben wurden.
Eine pauschale oder vage Angabe reicht nicht. Nur wenn alle relevanten Informationen vollständig und korrekt übermittelt werden, kann das Finanzamt die verkürzten Steuern korrekt nachberechnen. Eine Selbstanzeige, die nicht alle Details enthält, wird nicht anerkannt und schützt nicht vor einer Strafe.
Steuerrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Steuerberaterhaftung
Sie haben individuelle Fragen oder spezifische Themenwünsche für künftige Artikel? Dann kontaktieren Sie uns!
3. Wenn die Selbstanzeige nicht ordnungsgemäß eingereicht wird
Es gibt auch formelle Anforderungen, die bei der Selbstanzeige beachtet werden müssen. Wenn die Selbstanzeige unvollständig oder fehlerhaft ist, wird sie nicht anerkannt, und die strafbefreiende Wirkung entfällt.
Besondere Fälle: Was passiert, wenn der Steuerpflichtige keine Mitteilung vom Finanzamt erhält?
Es kommt immer wieder vor, dass Steuerpflichtige wichtige Briefe vom Finanzamt nicht erhalten. Ein Fall zeigt, wie problematisch dies sein kann:
Ein Steuerpflichtiger hatte eine Selbstanzeige eingereicht, als er von einer Steuerverkürzung erfuhr. Doch das Finanzamt lehnte die Selbstanzeige ab, weil bereits eine Außenprüfung angeordnet worden sei – und es war zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät.
Das Finanzamt hatte dem Steuerpflichtigen einen Brief zugeschickt, in dem die Außenprüfung angekündigt wurde. Der Steuerpflichtige bestritt jedoch, den Brief erhalten zu haben. Das Finanzamt konnte das Gegenteil nicht beweisen, da der Brief ohne spezielle Zustellung wie Einwurf-Einschreiben versendet worden war. Der Steuerpflichtige konnte deshalb dennoch eine Selbstanzeige einreichen.
Allerdings zeigt dieses Beispiel auch, wie wichtig es ist, dass Steuerpflichtige sicherstellen, dass alle Mitteilungen des Finanzamtes ordnungsgemäß zugestellt werden. Wenn der Steuerpflichtige keine Mitteilung erhält, kann die Situation im Einzelfall anders bewertet werden, aber grundsätzlich gilt: Eine Selbstanzeige ist nur dann sinnvoll, wenn sie rechtzeitig und vollständig erfolgt.
Fazit: Wann ist eine Selbstanzeige nicht mehr strafbefreiend?
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass eine Selbstanzeige im Steuerrecht nicht mehr strafbefreiend ist, wenn:
- Sie verspätet erfolgt, d. h. nach Beginn von Ermittlungen oder einer Außenprüfung.
- Sie unvollständig ist und nicht alle relevanten Steuerstraftaten offenlegt.
- Sie nicht korrekt eingereicht wird.
Die Selbstanzeige ist eine wertvolle Möglichkeit, um sich vor den strafrechtlichen Konsequenzen der Steuerhinterziehung zu schützen – jedoch nur, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Daher ist es entscheidend, im Falle einer Steuerstraftat schnell und vollständig zu handeln und gegebenenfalls rechtzeitig juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Haben Sie Fragen zur Selbstanzeige oder sind unsicher, ob Ihre Angaben vollständig sind? Kontaktieren Sie mich noch heute, um eine professionelle Einschätzung zu erhalten und rechtzeitig die notwendigen Schritte zu unternehmen: steuern-und-haftung.de/kontakt