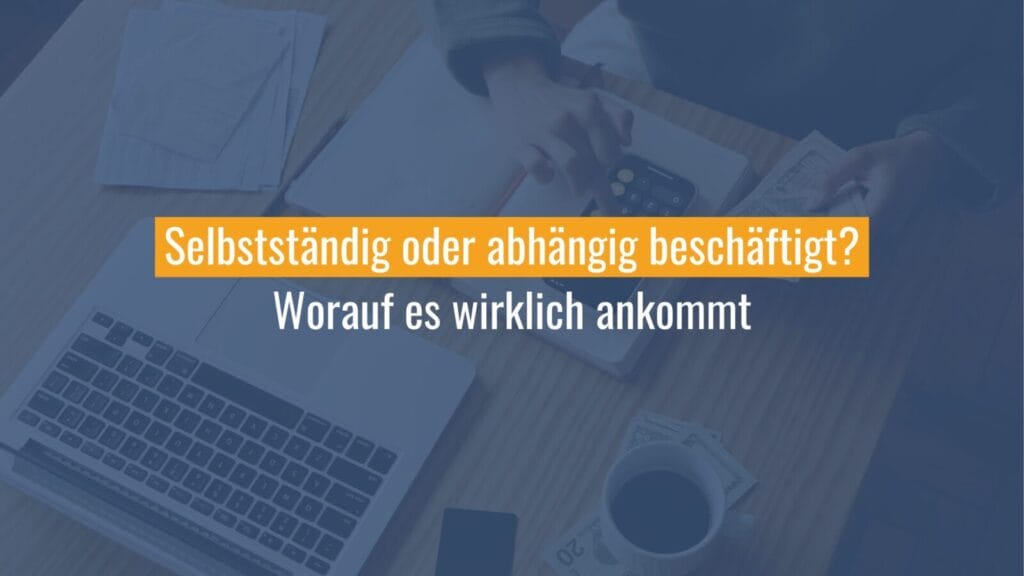Warum diese Abgrenzung entscheidend ist
Für Unternehmen ist es wirtschaftlich oft attraktiv, mit freien Mitarbeitern zu arbeiten. Sie gelten als flexibel einsetzbar und verursachen weniger Lohnnebenkosten. Doch das kann teuer werden: Wird ein freier Mitarbeiter im Nachhinein als abhängig Beschäftigter eingestuft, drohen hohe Nachzahlungen zur Sozialversicherung und ggf. sogar strafrechtliche Konsequenzen.
In Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherung gehört diese Fragestellung zur Standardroutine. Ein Prüfer der Rentenversicherung formulierte treffend, wie er an solche Fälle herangeht:
„Was macht dieser Mensch denn jetzt anders, als ein Angestellter machen würde?“
Wer sich mit dieser Frage ehrlich auseinandersetzt, kann viele Fehler vermeiden. Und genau diese Frage führt direkt zu den Abgrenzungskriterien, die wir im Folgenden genauer betrachten.
Selbstständigkeit: Diese Merkmale sollten erfüllt sein
Um den Status korrekt einzuschätzen, kommt es weniger auf die Vertragsform an, sondern vielmehr auf die tatsächliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Die Gerichte haben im Laufe der Jahre zahlreiche Indizien entwickelt, anhand derer echte Selbstständigkeit erkannt werden kann.
Die folgenden Merkmale gelten in der Rechtsprechung als typische Indizien für eine selbstständige Tätigkeit:
- Mehrere Auftraggeber:
Ein typisches Merkmal der Selbstständigkeit ist die gleichzeitige Tätigkeit für mehrere Kunden. Wer dauerhaft ausschließlich oder weit überwiegend für einen Auftraggeber arbeitet, begibt sich schnell in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, zumindest in den Augen der Rentenversicherung.
- Eigene Geschäftsausstattung und Betriebsmittel:
Selbstständige bringen ihre eigenen Arbeitsmittel mit, das können physische Werkzeuge im Handwerksbereich oder im digitalen Umfeld auch speziell angeschaffte Software, Lizenzen oder Systeme sein. Entscheidend ist, dass sie nicht vollständig auf vom Auftraggeber bereitgestellte Ressourcen angewiesen sind.
- Keine festen Arbeitszeiten oder Vorgaben zum Arbeitsort:
Ein freier Mitarbeiter bestimmt selbst, wann und wo er seine Aufgaben erledigt. Feste Arbeitszeiten oder eine Verpflichtung zur Anwesenheit in den Räumen des Auftraggebers sprechen eher für eine abhängige Beschäftigung.
- Keine Arbeit auf Weisung:
Selbstständige sind in ihrer Arbeitsweise frei und nicht weisungsgebunden. Sie legen eigenverantwortlich fest, mit welchen Mitteln und in welcher Reihenfolge sie ihre Leistungen erbringen.
- Unternehmerisches Risiko über bloßen Auftragsverlust hinaus:
Das Unternehmerrisiko zeigt sich etwa durch Investitionen, Vorleistungen oder das Risiko, bei Fehlern haften zu müssen. Es reicht nicht aus, dass ein Auftrag im nächsten Monat ausbleiben könnte; das Risiko trägt auch jeder Angestellte im Falle einer Kündigung.
- Keine Urlaubsregelung oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Freie Mitarbeiter haben keinen Anspruch auf bezahlten Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Derartige Leistungen sind klassische Kennzeichen eines Arbeitsverhältnisses.
- Eigene Marketingaktivitäten
Wer aktiv eigene Kunden akquiriert, etwa über eine professionelle Website, Social Media oder gezielte Werbung, dokumentiert unternehmerisches Handeln. Selbstvermarktung ist ein starkes Indiz für Selbstständigkeit.
- Eigene Rechnungsstellung
Freie Mitarbeiter stellen ihre eigenen Rechnungen an den Auftraggeber. Wenn dies nicht der Fall ist, wie es vereinzelt im Baugewerbe vorkommt, deutet dies auf eine Scheinselbstständigkeit hin, auch wenn auf dem Papier ein freier Vertrag besteht.
Diese Merkmale müssen nicht alle gleichzeitig vorliegen, aber je mehr davon erfüllt sind, desto klarer ist die Einordnung als Selbstständiger.
Steuerrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Steuerberaterhaftung
Sie haben individuelle Fragen oder spezifische Themenwünsche für künftige Artikel? Dann kontaktieren Sie uns!
Typische Anzeichen einer abhängigen Beschäftigung
Wenn der freie Mitarbeiter tatsächlich nach festen Arbeitszeiten arbeitet, dabei sämtliche Arbeitsmittel gestellt bekommt und seine Aufgaben nach klaren Anweisungen erledigt, unterscheidet sich seine Tätigkeit kaum von der eines klassischen Angestellten. Besonders kritisch ist es, wenn der Auftraggeber dem Freelancer vorgibt, wann er zu erscheinen hat, wie die Arbeit ausgeführt werden soll und welche Tools oder Zugänge zu nutzen sind.
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Eingliederung in betriebliche Abläufe. Wer in Teamstrukturen, Kommunikationswege oder Vertretungsregelungen eingebunden ist, ist organisatorisch oft nicht mehr unabhängig.
Beispiel aus der Praxis: Die „digitale Schaufel“
Ein klassisches Bild zur Verdeutlichung ist die Frage: Bringt der freie Mitarbeiter seine eigene Schaufel mit? Im handwerklichen Bereich ist das wörtlich zu verstehen: der Selbstständige nutzt eigenes Werkzeug, eigene Maschinen und Fahrzeuge. Im digitalen Kontext kann diese „Schaufel“ auch eine bestimmte Software, spezielle Tools, ein selbst entwickeltes System oder individuell eingerichtete Arbeitsumgebungen sein.
Wichtig ist, dass diese Arbeitsmittel selbst beschafft, bezahlt und regelmäßig eingesetzt werden. Wer hingegen mit einem vom Auftraggeber gestellten Laptop arbeitet, auf dessen Programme und Zugänge angewiesen ist und keine eigene Ausstattung vorweisen kann, erfüllt dieses Kriterium nicht. Dann liegt funktional oft keine echte Selbstständigkeit vor. Die „Schaufel“ muss zur Tätigkeit passen, aber sie sollte erkennbar dem eigenen unternehmerischen Risiko und der eigenen Organisation entstammen.
Sonderfall Rechnungsstellung durch Dritte
Ein häufig übersehenes, aber praxisrelevantes Thema ist die Rechnungsstellung. Zwar gilt es als selbstverständlich, dass Selbstständige ihre eigenen Rechnungen stellen, doch gerade in der Baubranche kommt es vor, dass der Auftraggeber diese Aufgabe übernimmt. Das ist ein deutliches Warnsignal. Wer noch nicht einmal über einen eigenen Laptop verfügt, geschweige denn über ein Rechnungsprogramm, ist schwerlich als eigenständig handelnder Unternehmer anzusehen.
Fazit: Auf das Gesamtbild kommt es an
Die korrekte Abgrenzung zwischen freiem Mitarbeiter und Angestelltem verlangt eine ehrliche Bestandsaufnahme. Entscheidend ist nicht, was im Vertrag steht, sondern wie die Tätigkeit im Alltag tatsächlich ausgestaltet ist. Unternehmer sollten regelmäßig prüfen, ob ihre freien Mitarbeiter tatsächlich wie Unternehmer agieren, oder ob sie faktisch in das Unternehmen eingebunden sind.
Ein sorgfältig dokumentierter Prozess, idealerweise ergänzt durch eigene Marketingaktivitäten und Investitionen des Auftragnehmers, stärkt die Position gegenüber den Sozialversicherungsträgern. Im Zweifel kann ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung für Klarheit sorgen – besser frühzeitig als nach einer unangenehmen Prüfung.
Sie sind unsicher, ob Ihre freie Mitarbeit rechtlich sicher aufgestellt ist?
Ich unterstütze Sie gerne bei der rechtssicheren Gestaltung Ihrer Verträge, der Prüfung bestehender Konstellationen und bei Fragen zur Statusfeststellung.Kontaktieren Sie mich für eine erste Einschätzung – bevor es der Betriebsprüfer tut: steuern-und-haftung.de/kontakt