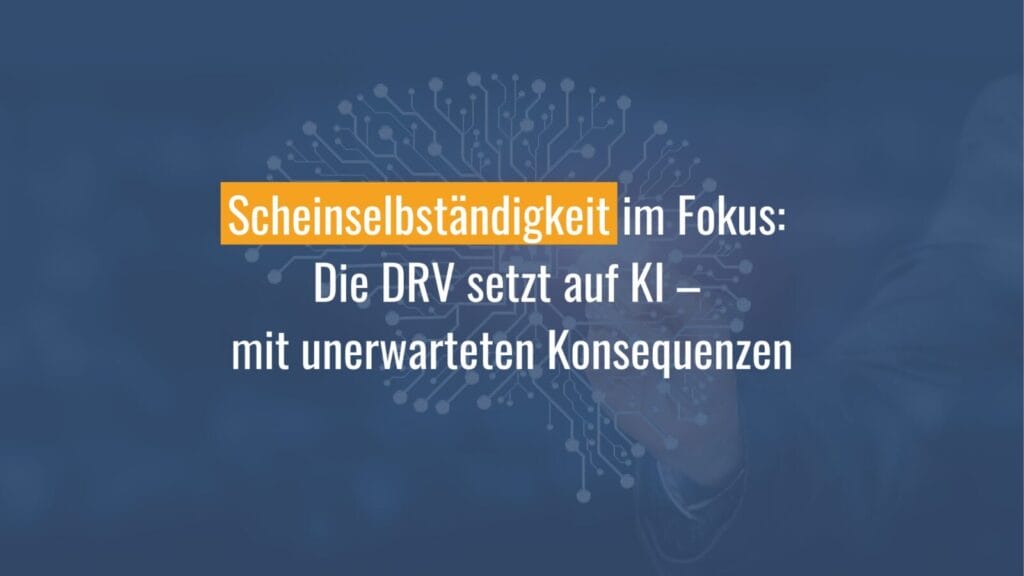Rechtliche Unsicherheiten bei freien Mitarbeitern: Scheinselbständigkeit im Fokus
In der heutigen Arbeitswelt, in der immer mehr Menschen als freie Mitarbeiter tätig sind, kommt es zunehmend zu rechtlichen Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf die Scheinselbständigkeit. Das Thema hat vor allem im Kontext von freien Mitarbeiterverträgen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Besonders die Deutsche Rentenversicherung (DRV) widmet sich intensiv der Frage, ob eine Scheinselbständigkeit vorliegt, was zu erheblichen Konsequenzen hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge führen kann. In diesem Zusammenhang spielt die Künstliche Intelligenz (KI) eine immer größere Rolle. Doch wie wird das Thema Scheinselbständigkeit von der DRV bewertet, und was hat die neue KI-Lösung der DRV damit zu tun?
Die Prüfung von freien Mitarbeiterverträgen durch die DRV
Freie Mitarbeiterverträge sind für viele Unternehmen ein gängiges Modell, um flexibel Personal zu beschäftigen. Doch diese Form der Beschäftigung ist nicht ohne Risiko, da die Deutsche Rentenversicherung bei einer Betriebsprüfung genau hinschaut, ob es sich um eine echte Selbstständigkeit handelt oder ob nicht doch eine abhängige Beschäftigung vorliegt. In letzterem Fall kämen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen auf das Unternehmen zu.
Besonders kritisch wird die Situation, wenn die Rentenversicherung annimmt, dass eine Scheinselbständigkeit vorliegt. Was zur Folge hat, dass für ihn Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen. Der Arbeitgeber des vermeintlich Selbständige muss nachträglich Sozialversicherungsbeiträge zahlen, die er für den freien Mitarbeiter ursprünglich nicht entrichtet hat. Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung ergeben dann erhebliche Nachforderungen.
Was ist Scheinselbständigkeit?
Scheinselbständigkeit liegt vor, wenn eine Person formal als Selbständiger arbeitet, tatsächlich jedoch in einer abhängigen Beschäftigung tätig ist. Dies bedeutet, dass der freie Mitarbeiter in einem Maße in die Arbeitsorganisation eines Unternehmens eingebunden ist, dass er nicht mehr wie ein echter Selbständiger arbeitet, sondern wie ein regulärer Arbeitnehmer.
Typische Merkmale sind etwa:
1. Weisungsgebundenheit:
Der Mitarbeiter ist in der Auswahl der Arbeitszeit, des Arbeitsorts und der Art der Arbeit stark eingeschränkt und unterliegt den Weisungen des Auftraggebers.
2. Betriebliche Eingliederung:
Der Mitarbeiter arbeitet direkt in den betrieblichen Abläufen mit, nutzt die gleichen Ressourcen und wird wie ein Angestellter behandelt.
3. Fehlendes Unternehmerrisiko:
Ein echter Selbständiger trägt das Risiko eines Auftragsverlustes oder finanzieller Schwankungen. Bei einem scheinselbständigen Arbeitnehmer hingegen fehlt dieses Risiko.
Steuerrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Steuerberaterhaftung
Sie haben individuelle Fragen oder spezifische Themenwünsche für künftige Artikel? Dann kontaktieren Sie uns!
Die DRV und die Finanzbuchhalterin: Ein Fall von Scheinselbständigkeit
Ein interessantes Beispiel für die Prüfung von Scheinselbständigkeit bietet ein Fall vor dem Landessozialgericht Hamburg im Jahr 2023.
In diesem Fall ging es um eine freiberuflich tätige Finanzbuchhalterin, die für ein Steuerbüro arbeitete. Die Deutsche Rentenversicherung stellte im Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass die Finanzbuchhalterin, trotz ihrer vertraglichen Vereinbarungen als freie Mitarbeiterin, als scheinselbstständig zu werten sei und forderte Sozialversicherungsbeiträge nach. Die DRV begründete dies mit mehreren Punkten:
Eingliederung in die Betriebsorganisation:
Die Finanzbuchhalterin arbeitete in den Räumen des Steuerbüros, nutzte dessen Buchhaltungssoftware (DATEV) und war in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. Sie hatte keinen festen Arbeitsplatz, aber sie war dennoch weitgehend in die Struktur des Unternehmens eingebunden.
Fehlendes Unternehmerrisiko:
Die Finanzbuchhalterin hatte keine nennenswerten Investitionen getätigt und trug kein signifikantes finanzielles Risiko. Ihre Vergütung war zudem nicht erfolgsabhängig, was typisch für eine abhängige Beschäftigung ist.
Weisungsgebundenheit:
Die DRV argumentierte, dass die Finanzbuchhalterin regelmäßig nach den Vorgaben des Steuerbüros arbeitete und damit einer gewissen Weisungsgebundenheit unterlag. Zwar war sie nicht an feste Arbeitszeiten gebunden, aber sie war verpflichtet, ihre Arbeiten im Einklang mit den Anforderungen des Steuerbüros zu erledigen, was die Unabhängigkeit weiter infrage stellte.
Die DRV ging somit davon aus, dass die Finanzbuchhalterin wie ein regulärer Arbeitnehmer arbeitete und daher sozialversicherungspflichtig war.
Das Urteil des Landessozialgerichts Hamburg: Keine Scheinselbständigkeit
Das Landessozialgericht Hamburg (Urteil vom 23.02.2023, Az. L 1 BA 7/22) widersprach jedoch dieser Auffassung und stellte fest, dass keine Scheinselbständigkeit vorlag. Das Gericht führte aus, dass die Finanzbuchhalterin keine abhängige Beschäftigung ausübte, sondern tatsächlich selbstständig tätig war. Die Gründe diese Entscheidung waren:
Freiheit der Arbeitsgestaltung:
Das Gericht betonte, dass die Finanzbuchhalterin in keiner Weise weisungsgebunden war. Sie konnte ihre Arbeitszeiten und den Arbeitsort frei wählen. Zwar nutzte sie die Buchhaltungssoftware des Steuerbüros, aber dies war vor allem praktischen Erwägungen geschuldet: Als Nicht-Steuerberaterin hätte sie ohne diesen Zugang keine effektive Arbeit leisten können. Das Gericht sah in dieser Nutzung keine Eingliederung in die Betriebsorganisation des Steuerbüros, da sie weiterhin die Freiheit hatte, ihre Arbeit nach eigenem Ermessen zu gestalten.
Keine Eingliederung in die Betriebsorganisation:
Ein weiteres wichtiges Argument des Gerichts war, dass die Finanzbuchhalterin keinen festen Arbeitsplatz im Büro hatte und auch keinen ständigen Zugang zu den Räumlichkeiten des Steuerbüros besaß. Sie arbeitete nur dann im Büro, wenn ein Arbeitsplatz mit Zugang zur Buchhaltungssoftware verfügbar war. Zudem war sie nicht in die allgemeine Büroorganisation eingebunden, etwa durch Aufgaben wie Telefondienst oder andere betriebliche Tätigkeiten.
Unternehmerisches Risiko:
Die Finanzbuchhalterin trug ein gewisses unternehmerisches Risiko, da sie für mehrere Auftraggeber tätig war und die Freiheit hatte, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen. Diese unternehmerische Freiheit und das Fehlen einer festen Bindung an einen einzigen Auftraggeber sprachen klar gegen eine abhängige Beschäftigung.
Vertragliche Regelungen und tatsächliche Ausführung:
Das Gericht wies darauf hin, dass die vertraglichen Regelungen zur freien Mitarbeit ebenfalls nicht mit einer abhängigen Beschäftigung in Einklang standen. Insbesondere war die Finanzbuchhalterin nicht verpflichtet, die Arbeiten persönlich auszuführen, sondern konnte auch andere Personen mit der Erledigung von Aufgaben beauftragen. Dies entspricht den typischen Merkmalen einer selbstständigen Tätigkeit.
Die Rolle der Künstlichen Intelligenz bei der DRV
Die Deutsche Rentenversicherung hat erkannt, dass die manuelle Prüfung von freien Mitarbeitern und der Status von Scheinselbständigkeit zunehmend schwieriger wird, insbesondere bei der Vielzahl an Verträgen und individuellen Arbeitsverhältnissen. Deshalb setzt die DRV zunehmend auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um diese Prüfungen automatisiert und effizient durchzuführen.
Interessanterweise lässt die DRV die KI-Lösung von freiberuflichen Programmierern entwickeln, die unter Projektverträgen für die Rentenversicherung tätig sind. Diese freiberuflichen IT-Spezialisten werden dann an den Systemen der DRV arbeiten, möglicherweise sogar mit Schlüsseln für die Büros und festen Arbeitsplätzen ausgestattet.
Genau diese Arbeitsweise könnte als Scheinselbständigkeit eingestuft werden, da sie typische Merkmale einer abhängigen Beschäftigung erfüllen – wie etwa den festen Arbeitsplatz, die Nutzung firmeneigener Ressourcen und die Eingliederung in die Betriebsorganisation.
Ironie in der Situation: Die DRV selbst in der Prüfung
Es ist geradezu ironisch, dass die Deutsche Rentenversicherung eine KI entwickeln lässt, um Scheinselbständigkeit zu prüfen, während die Entwickler dieser KI-Lösung selbst unter freiberuflichen Bedingungen arbeiten, die den Kriterien für eine Scheinselbständigkeit entsprechen. Diese freiberuflichen IT-Spezialisten arbeiten an einem System, das später dazu verwendet wird, ihre eigenen Arbeitsverhältnisse zu überprüfen und möglicherweise als scheinselbstständig zu klassifizieren.
Die DRV könnte damit in eine interessante Situation geraten, in der ihre eigenen freiberuflichen Mitarbeiter durch die KI, die sie entwickeln lässt, geprüft und möglicherweise als scheinselbstständig eingestuft werden. Es stellt sich die Frage, ob die Rentenversicherung in diesem Kontext auch ihre eigenen Arbeitsverhältnisse prüfen muss, um sicherzustellen, dass sie selbst nicht gegen die eigenen Prüfstandards verstößt. Sollte es zu dieser Konfrontation kommen, könnte dies zu einer Selbstprüfung führen, die zeigt, wie die DRV mit den eigenen Regeln für freiberufliche Mitarbeit umgeht.
Fazit: Komplexität der Scheinselbständigkeit und die Rolle der KI
Die Abgrenzung zwischen freier Mitarbeit und Scheinselbständigkeit bleibt ein komplexes Thema, das nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Deutsche Rentenversicherung zunehmend schwieriger wird.
Das neue KI-System, das zur Prüfung von Scheinselbständigkeit eingesetzt wird, könnte eine effiziente Lösung darstellen, jedoch könnte die DRV in die Situation geraten, ihre eigenen Arbeitsverhältnisse hinterfragen zu müssen.
Unternehmen und freiberufliche Mitarbeiter müssen daher genau auf die rechtlichen Rahmenbedingungen achten, um nicht von unangemessenen Sozialversicherungsbeiträgen betroffen zu werden. Die Entwicklung und der Einsatz von KI bei der DRV wird den Umgang mit diesen Fragen in Zukunft noch weiter verändern.
Das Urteil des Landessozialgerichts Hamburg vom 23. Februar 2023, das sich mit der Frage der Scheinselbständigkeit einer freiberuflich tätigen Buchhalterin beschäftigt, können Sie hier nachlesen: Landessozialgericht Hamburg – 23.02.2023
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder rechtliche Beratung benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie mich einfach.